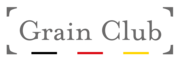Rolle des internationalen Agrarhandels für die Welternährung
Die Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) geht davon aus, dass diese Faktoren bis zum Jahr 2050 eine Steigerung der weltweiten Nahrungsmittelproduktion um etwa 60 Prozent notwendig macht (vgl. Abb. 1).
Abb. 1: Entwicklung der Nachfrage nach Nahrungsmitteln bis 2050
Quelle: FAO, World Agriculture 2030/2050, The 2102 Revision, Rome 2012
Auch wenn in den letzten Jahrzehnten gewaltige Fortschritte bei der Bekämpfung des Hungers in der Welt erzielt wurden, leiden gegenwärtig immer noch mehr als 800 Mio. Menschen, insbesondere in Afrika und Asien, unter Hunger und Mangelernährung. Deshalb muss neben verstärkten Anstrengungen für eine gleichmäßige Verteilung von Nahrungsmitteln auch die Verbesserung der Ernährungssituation in den betroffenen Regionen in quantitativer und qualitativer Hinsicht eines der herausragenden Anliegen von Agrar-, Entwicklungs- und Handelspolitik sein.
Eine tragende Rolle – vor allem unter dem Aspekt der Ernährungssouveränität – muss bei den Bemühungen um die Verringerung des Hungers in der Welt die Förderung einer modernen, innovativen Landwirtschaft spielen. Dies belegen auch aktuelle Studien der Welternährungsorganisation FAO: moderne Landwirtschaft und Intensivierung der Erzeugung haben die Welternährung in den letzten Jahrzehnten verbessert und den Hunger in der Welt verringert und nicht Regionalität und eine Extensivierung der Produktion.2 Dies steht nicht im Widerspruch zu der notwendigen Förderung und Stärkung der Kleinbauern, die die Landwirtschaft in vielen Entwicklungsländern auch in Zukunft prägen werden.
Die Bekämpfung des Hungers bleibt dennoch eine große Herausforderung und erfordert eine Vielzahl von Maßnahmen. Die Vereinten Nationen haben deshalb im Oktober 2015 die „Millenium Development Goals“ zu den „Sustainable Development Goals“ (SDG) weiterentwickelt und dabei festgelegt, welche Maßnahmen notwendig sind, um in den nächsten 15 Jahren, bis 2030, den Hunger in der Welt wirksam zu bekämpfen. Das Ziel 2 der SDG lautet entsprechend: “End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable agriculture”. Um dieses Ziel zu erreichen, halten die Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen u.a. eine Verdoppelung der Flächenproduktivität in Entwicklungs- und Schwellenländern für notwendig. Dies soll in erster Linie durch die Stärkung der Agrarforschung und einen verbesserten Zugang zu Betriebsmitteln (Saatgut, Pflanzenschutz, Düngemittel, moderner angepasster Technik) erreicht werden. Gleichzeitig sind hohe Investitionen in die Infrastruktur insbesondere zur Vermeidung von Nachernteverlusten notwendig. Ebenso müssen funktionierende Märkte und Preisinformationssysteme aufgebaut werden.
1. Bedeutung des Agrarhandels für die Welternährung
Neben der Förderung von Innovation und Produktivität kommt dem internationalen Agrarhandel eine bedeutende Rolle bei der Bekämpfung des Hungers zu. Grundsätzlich sind internationale Agrar- und Rohstoffmärkte für den Ausgleich von Angebot und Nachfrage und damit auch von Mangel und Überschuss unverzichtbar. Hinzu kommt, dass viele Länder, die über ein hohes Bevölkerungswachstum verfügen und in agronomisch ungünstigen Klimazonen liegen (u.a. Nordafrika, Naher und Mittlerer Osten), trotz aller Bemühungen um Ernährungssouveränität auch in Zukunft nicht in der Lage sein werden, ihren Bedarf an Nahrungsmitteln vollständig aus heimischer Erzeugung zu decken. Diese Entwicklung wird in Zukunft gerade in diesen Ländern durch die Auswirkungen des erwarteten Klimawandels noch verstärkt werden. Das Ziel 2 der SDG nimmt diese Entwicklung explizit auf und fordert die Unterbindung von handelsverzerrenden Praktiken, insbesondere von Exportsubventionen (wie bereits in der WTO vereinbart).
Basierend auf diesen Überlegungen sagen die jährlichen Prognosen der OECD und der FAO ein kräftiges Wachstum des Weltagrarhandels für die Entwicklung der Weltagrarmärkte in den nächsten 10 Jahren voraus. Die jüngste Prognose für den Zeitraum 2016 bis 2025 geht zwar von einem im Vergleich zur vorherigen Dekade kleinerem, aber unverändert deutlichem Wachstum des Welthandels mit Agrarprodukten aus (vgl. Abb. 2).
Abb. 2: Entwicklung des Welthandels mit Agrarprodukten bis 2025
Quelle: OECD-FAO Agricultural Outlook 2016-2025
Der internationale Agrarhandel leistet heute und in Zukunft einen signifikanten Beitrag zur Verbesserung der Situation vieler Landwirte und damit zur Verringerung des Hungers in der Welt. Zu diesem Schluss kommt auch der Wissenschaftliche Beirat für Agrarpolitik, Ernährung und gesundheitlichen Verbraucherschutz des BMEL in einer Stellungnahme aus dem Jahre 2012 zum Thema „Ernährung und nachhaltige Produktivitätssteigerung“:
„Auch aus einer breiteren Nachhaltigkeitsperspektive ist der internationale Agrarhandel von zentraler Bedeutung. Vor dem Hintergrund globaler Knappheiten und einer regional sehr unterschiedlichen Ressourcenausstattung sollten Nahrungsmittel und andere Agrarprodukte dort produziert werden, wo die jeweils knappen Ressourcen am effizientesten genutzt werden. Der internationale Handel ermöglicht eine solch global effiziente Ressourcennutzung, zumindest dann, wenn Umwelteffekte der Produktion und des Transports nicht externalisiert werden.“
2. Bedeutung der EU für den internationalen Agrarhandel
Die EU ist bereits seit vielen Jahren die weltgrößte Einfuhrregion für Agrargüter. Gleichzeitig ist sie eines der führenden Agrarexportländer der Welt. Im Gegensatz zur Vergangenheit werden diese Exporte – bis auf wenige temporäre Ausnahmen – seit 2010 nicht mehr subventioniert. In der Vergangenheit haben die subventionierten Agrarausfuhren der EU, wie auch der der USA und anderer Länder immer wieder zu Marktverzerrungen insbesondere in Entwicklungsländern geführt und dem Aufbau funktionierender heimischer Märkte im Wege gestanden. Dies ist heute nicht mehr der Fall.
Die EU hat die Stellung der Entwicklungsländer im internationalen Agrarhandel gleichzeitig über die Öffnung der eigenen Märkte deutlich gestärkt und damit Verantwortung für die weltweite Ernährungssituation und Ernährungssicherung übernommen. Über eine Vielzahl von Handelsabkommen wurde insbesondere Entwicklungsländern für fast alle Produkte außer Waffen freier Zugang (keine Zollbelastung) zu den Märkten der EU ermöglicht. Die EU ist damit weltweit einer der am offensten Märkte für Agrarprodukte, die von Entwicklungs- und Schwellenländern ausgeführt werden (siehe weiter unten).
Aus der folgenden Abbildung lässt sich die Entwicklung des EU Agraraußenhandels zwischen 2002 und 2014 ablesen.
Abb. 3: Entwicklung des EU Außenhandels mit Agrarprodukten
Table A-2: EU-28: EXTRA TRADE - Agriculture and Food in Mill EURO, 2002-2014
Quelle: EUROSTAT
3. Handelsabkommen der EU
Die Agrarwirtschaft der EU und damit auch Deutschlands ist durch die fortschreitende
Internationalisierung der Märkte auch im internationalen Agrarhandel in die globalen Märkte eingebunden. Hierfür hat die EU mit einer Vielzahl von Handelsabkommen zwischen einzelnen oder mehreren Staaten oder Regionen die Rahmenbedingungen festgelegt.
Besonders hervorzuheben ist dabei das Wirtschaftspartnerschaftsabkommen (WPA) bzw. „Economic Partnership Agreement“ (EPA), in dem die EU mit 78 afrikanischen, karibischen und pazifischen Staaten (sogenannte AKP-Staaten) eine Freihandelszone gebildet hat. Über das Schema allgemeiner Zollpräferenzen („Generalised System of Preferences“ – GSP) gewährt die EU fast allen Entwicklungsländern einen bevorzugten Zugang zum EU-Markt.
Mit der Initiative „Alles außer Waffen“ („Everything But Arms“ – EBA), wird 49 besonders bedürftigen Entwicklungsländern („Least Developed Countries“ – LDC) der zoll- und kontingentfreie Zugang zum EU-Markt für alle Produkte außer Waffen und Munition ermöglicht.
4. Deutschlands Agraraußenhandel
Deutschland ist angesichts guter Böden, ausreichend verfügbarem Wasser und hervor-
ragender Technisierung ein Gunststandort für die nachhaltige Erzeugung und für die Weiterverarbeitung agrarischer Rohstoffe. Unsere Anbauflächen effizient und nachhaltig zu nutzen, ist nicht zuletzt auch angesichts des Hungers in der Welt und daraus zum Teil resultierender Flüchtlingsströme ein ethisch moralisches Gebot.
Deutschland ist nach wie vor Nettoimporteur von Nahrungsmitteln, obwohl Deutschland den Wert seiner Agrarexporte in den letzten 10 Jahren mehr als verdoppeln konnte.
Abb. 4: Entwicklung der deutschen Agrarexporte
Quelle: BMEL, Deutscher Agraraußenhandel 2015, Daten und Fakten, Berlin 2016
In 2015 hat der deutsche Agraraußenhandel weiter zugenommen. Insgesamt wurden Agrar- und Ernährungsgüter im Wert von 65,4 Milliarden Euro ausgeführt, während die Einfuhren 74,5 Milliarden Euro ausmachten. Deutschland blieb damit auch 2015 ein Nettoeinfuhrland für Agrargüter. Dabei übertrafen die Einfuhren aus Nicht-EU-Ländern die Ausfuhren in diese Länder um mehr als 8 Milliarden Euro. Der Handel mit den Mitgliedsstaaten der EU war dagegen weitgehend ausgeglichen.
Deutschland hat in den letzten Jahren nicht nur bei verarbeiteten Agrarprodukten hohe Zuwachsraten im Export erzielt. Gleiches gilt beispielsweise auch für Getreide. Mittlerweile exportiert Deutschland jährlich ca. 12 - 15 Mio. t Weizen, wovon ca. 7-10 Mio. in Drittländer der EU ausgeführt werden. Die Exporte von Gerste belaufen sich auf ca. 3 Mio. t. Die wichtigsten Einfuhrländer von deutschem Weizen liegen in Regionen, die eine stark wachsende Nachfrage aufweisen, aber selbst aus agronomischen und klimatischen Gründen nicht in der Lage sind, diese Nachfrage ausschließlich aus heimischer Erzeugung zu befriedigen. Hierzu gehören insbesondere der Iran, Saudi-Arabien und die nordafrikanischen Länder Marokko und Algerien. Diese Länder haben in den letzten Jahren eine Präferenz für deutschen Weizen entwickelt, da er qualitativ hochwertig und am besten für die Anforderungen dieser Länder an deren Brotproduktion geeignet ist.
Diese Zahlen dokumentieren, dass der Agrarhandel für die deutsche Agrarwirtschaft enorme Bedeutung hat. Bezogen auf die Verkaufserlöse der Landwirtschaft zeigen Schätzungen, dass mittlerweile mehr als ein Viertel der Verkaufserlöse indirekt aus dem Export von Agrar- und Ernährungsgütern stammt.5
Ebenso wichtig bleibt der Zugang zu Importen von Rohstoffen, die in der EU und Deutschland nicht in ausreichendem Maße selbst erzeugt werden können. Dies gilt insbesondere für die Einfuhr von Eiweißfuttermitteln für die Tierproduktion.
5. Fazit
Der internationale Agrarhandel leistet einen entscheidenden Beitrag zur Ernährungssicherung in vielen Entwicklungs- und Schwellenländern. Dieser Beitrag beschränkt sich nicht nur auf den Ausgleich der von durch Dürre, Überschwemmungen oder anderer Naturkatastrophen bedingter Mängel oder Unterversorgung der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln. Vielmehr wird durch den internationalen Handel mit Agrarrohstoffen ein ökonomischer Vorteil für beide Handelspartner erzielt. Gemäß dem Prinzip der komparativen Kostenvorteile ist die Spezialisierung auf bestimmte Produkte und deren Handel für die Beteiligten vorteilhaft.
Bei der Betrachtung des internationalen Agrarhandels darf nicht übersehen werden, dass es auch nach dem Wegfall der Exportsubventionen unverändert zu Verzerrungen im Agrarhandel kommt. In diesem Zusammenhang sind insbesondere die nicht-tarifären Handelshemmnisse wie Qualitätsstandards und über den gesetzlichen Vorschriften liegende Anforderungen an die Lebensmittelsicherheit zu nennen. Hieraus resultieren immer wieder Marktzugangsbeschränkungen. Diese wirken sich insbesondere negativ für Entwicklungsländer aus, weil sie ihnen häufig die Möglichkeit nehmen, über den Agrarexport die wirtschaftliche Situation ihrer Landwirtschaft zu verbessern.
Der Grain Club unterstützt deshalb die in den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen enthaltene Forderung nach einem Verzicht auf den Agrarhandel beschränkende Maßnahmen sowie einem weiteren Abbau von handelsverzerrenden Praktiken in den Agrarmärkten.
Berlin, Bonn und Hamburg September 2016
Quellen:
1 www.fao.org/hunger/key-messages/en/
2 FAO, The State of Food and Agriculture, Rom 2014
3 www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
4 BMEL, Stellungnahme des Wissenschaftlichen Beirats für Agrarpolitik beim Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz „Ernährung und nachhaltige Produktivitätssteigerung“, 2012
5 BMEL, Deutscher Agraraußenhandel 2015, Daten und Fakten, Berlin 2016
Kontakt Grain Club:
Geschäftsstelle
Pariser Platz 3, 10117 Berlin
Tel: 030 856 214-440, Fax: 030 856 214-522
E-Mail: info@grain-club.de
Internet Grain Club: www.grain-club.de
Twitter: @GrainClub