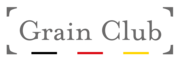Keine Ernährungssicherung ohne effiziente Landwirtschaft - Sachliche Diskussion beim Pflanzenschutz gefordert
1. Nutzen des Pflanzenschutzes
Die moderne Landwirtschaft sorgt zuverlässig dafür, dass dem Verbraucher ausreichend qualitativ hochwertige und sichere Lebensmittel zu erschwinglichen Preisen zur Verfügung stehen.
Fortschrittliche Methoden der Landbewirtschaftung, zu denen unter anderem der Pflanzenschutz gehört, tragen wesentlich zu diesem Erfolg bei.
Vor dem Hintergrund der steigenden Weltbevölkerung ist der Pflanzenschutz ein entscheidender Faktor zur Ernährungssicherung.
Dauerversuche des Julius Kühn-Instituts zeigen, dass eine Reduzierung des chemischen Pflanzenschutzes das Risiko von Ertragsverlusten um mehr als 25 Prozent erhöht.1
Der generelle Verzicht auf chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel verursacht starke Mindererträge. Je nach Standort, Bodenbearbeitung, Art und Sorte ergaben die Dauerversuche Ertragsverluste durch Schadorganismen von 20 bis 75 Prozent bei Getreide, von 25 Prozent bei Kartoffeln und von zehn bis 30 Prozent bei Mais. Ertragsverluste in dieser Größenordnung können die Selbstversorgung mit heimischen Agrarprodukten gefährden und führen zu einer Verschiebung der Handelsbilanz hin zu mehr Importen. Im Zusammenwirken von Landwirtschaft, Handel und Verarbeitern sowie den komplexen Strukturen der internationalen Märkte führen isolierte agrarpolitische Maßnahmen in diesem Bereich zu Wettbewerbsverzerrungen.
Durch eine politisch motivierte Beschränkung des Betriebsmitteleinsatzes ist eine Abwanderung der Produktion in Weltregionen zu erwarten, in denen das Ertragspotenzial je Flächeneinheit deutlich geringer ist als an den Gunststandorten Europas. Dies ist nicht mit dem Ziel der Schonung der knappen Ressource Boden vereinbar. Wird durch den Einsatz moderner Betriebsmittel (u.a. Pflanzenschutzmittel) weniger Ackerfläche benötigt, schont das die globale Biodiversität.
Darüber hinaus entspricht die Produktion außerhalb Europas häufig nicht unseren strengen Standards des Verbraucher- und Umweltschutzes.
Neben der Ertragssicherung ist der Pflanzenschutz auch für die Lebens- und Futtermittelsicherheit entscheidend, zum Beispiel um die Belastung der Ernteprodukte mit Mykotoxinen (Pilzgiften) so gering wie möglich zu halten.
2. Wissenschaftsbasierte Risikobewertung von Pflanzenschutzmitteln
Für die Zulassung von Pflanzenschutzmitteln sind im Pflanzenschutzgesetz auf Basis des EU-Rechts strenge Maßstäbe festgelegt. Um die Sicherheit der Produkte weiter zu erhöhen, steigen die Anforderungen für die Zulassung ständig.
In regelmäßigen Abständen wird erneut überprüft, ob ein Produkt und sein Wirkstoff noch den Anforderungen entsprechen, die man nach neuestem Stand der Wissenschaft an ein sicheres und umweltverträgliches Pflanzenschutzmittel stellt.
Wirkstoffe werden EU-weit nach einer umfangreichen wissenschaftlichen Prüfung durch die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) und die zuständigen Behörden in den Mitgliedstaaten genehmigt.
In Deutschland bewerten unabhängige Behörden wie etwa das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) die möglichen Auswirkungen auf die Gesundheit von Mensch und Tier auf Risikobasis.
Das Umweltbundesamt (UBA) bewertet mögliche Auswirkungen auf den Naturhaushalt sowie das Verhalten in der Umwelt. Das Julius Kühn-Institut (JKI) prüft die Wirksamkeit, die Pflanzenverträglichkeit sowie die praktische Anwendung und den Nutzen.2,3
In der öffentlichen Diskussion wird zunehmend vom Grundsatz der wissenschaftlichen Risikobewertung abgewichen und die Neutralität der an der Zulassung von Pflanzenschutzmitteln beteiligten Behörden angezweifelt. Das führt zur Verbraucherverunsicherung und untergräbt die Autorität der relevanten Institute nachhaltig. Eine Abkehr vom Wissenschaftsprinzip hätte nicht nur verheerende Auswirkungen auf die Agrar- und Ernährungswirtschaft, sondern auch auf alle anderen Bereiche der Wirtschaft, die auf wissenschaftliche Bewertungen angewiesen sind.
Forderungen des Grain Clubs
1. Der Grain Club lehnt nationale Alleingänge bei agrarpolitischen Entscheidungen über die zukünftige Ausgestaltung der modernen Landwirtschaft ab, da diese zu Wettbewerbsverzerrungen führen.
2. Der Grain Club fordert die Bundesregierung auf, sich zu den gültigen wissenschaftlichen Prüfungsverfahren zu bekennen und somit auch das Vertrauen in die Arbeit der eigenen und der europäischen Institutionen zu untermauern.
3. Die Weiterentwicklung des Integrierten Pflanzenschutzes ist zudem im Aktionsplan zur nachhaltigen Anwendung von Pflanzenschutzmitteln (NAP) festgeschrieben.4 Der Grain Club fordert die Bundesregierung auf, die im NAP enthaltenen Maßnahmen mit Nachdruck umzusetzen.
4. Ausdrücklich begrüßt der Grain Club jeden Dialog, sofern er der sachlichen Meinungsbildung dient. Die öffentliche Diskussion bietet die Chance, mit allen Interessenvertretern Konzepte zum Schutz der Nutzpflanzen vor Krankheiten und Schädlingen weiterzuentwickeln. In diesem Kontext setzt sich der Grain Club für eine Innovationsförderung und Fortentwicklung der Ressortforschung ein.
Berlin, Bonn und Hamburg August 2017
Quellen
1. Schwarz, J.; Pallutt, B.; Gehring, K.; Weinert, J. (2010): Untersuchungen zum notwendigen Maß bei der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln im Ackerbau – Ergebnisse bundesweiter Dauerfeldversuche: Julius-Kühn-Archiv 428: 57. Deutsche Pflanzenschutztagung in Berlin, 6.-9. September 2010, S. 474
2. www.bmel.de/DE/Landwirtschaft/Pflanzenbau/Pflanzenschutz/_Texte/Pflanze
nschutzmittel-Dossier.html?docId=2050922
3. www.umweltbundesamt.de/themen/chemikalien/pflanzenschutzmittel/zulassung-von-pflanzenschutzmitteln
4. https://www.nap-pflanzenschutz.de/
Kontakt Grain Club
Geschäftsstelle
Pariser Platz 3, 10117 Berlin
Tel: 030 856 214-440, Fax: 030 856 214-522
E-Mail: info@grain-club.de
Internet Grain Club: www.grain-club.de
Twitter: @GrainClub